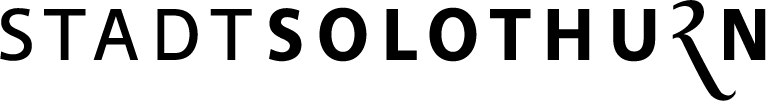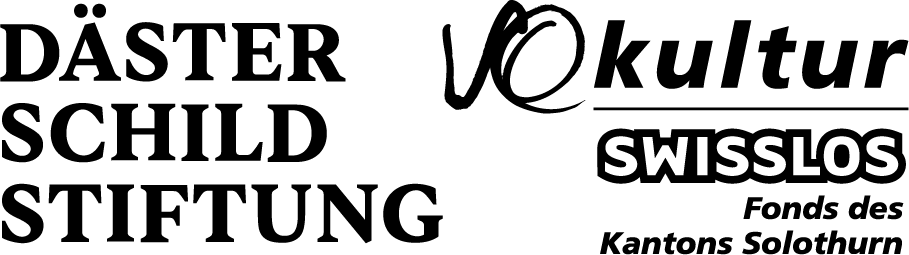Das Kunstmuseum Solothurn und die Solothurner Filmtage setzen in ihrer ersten umfassenden Zusammenarbeit den Jura in Szene, jenes Gebiet, das Solothurn beheimatet und gleichzeitig eine Brücke über Landes- und Sprachgrenzen hinweg schlägt – von Baselland über die Neuenburger Täler bis weit nach Frankreich hinein.
In einer multidisziplinären Ausstellung, die im 18. Jahrhundert startet und bis in die Gegenwart führt, lenkt das Kunstmuseum Solothurn den Blick auf die Jura-Landschaft als Schauplatz und Motiv. Sie nimmt das Publikum mit auf eine Reise quer durch das visuelle Erbe einer Region und fragt nach deren künstlerischer Biografie, die mal in leiseren, mal in drastischeren Tönen von unterschiedlichen Auffassungen und Realitäten zeugt.
Die Schau vereint Malerei und Fotografie im Dialog und spannt den Bogen weiter von Filmdokumenten bis hin zu Werken von Anne und Jean Rochat oder Augustin Rebetez, die eigens für das Projekt entstanden sind. Die 60. Solothurner Filmtage (22.–29.1.25) widmen dem Drehort Jura ein Spezialprogramm, das mit einer internationalen Retrospektive und aktuellen Filmen die Topografie des Jurabogens erkundet.
Der Jura, eine Sehnsuchtslandschaft?
Bereits in der Vorromantik verdankt der Maler Caspar Wolf dem Solothurner Jura die Vision eines Künstlers, der ins Innere der Erde, in die Zone unerforschter Geheimnisse vorzudringen wagt. Daran erinnert Das Innere der Bärenhöhle bei Welschenrohr von 1778, ein kleines Bild mit grosser Anziehungskraft. Wenig früher findet Jean-Jacques Rousseau sein Modell eines «Bergarkadiens» nicht etwa in den Alpen, sondern im Neuenburger Jura. Rousseaus temporäre Aufenthalte in Môtiers und auf der St. Petersinsel ziehen zahlreiche weitere Bewundernde an und setzen das Juragebirge auf die Route der Grand Tour gelehrter Schweizbesucher*innen. Auf den Spuren des Philosophen und Naturforschers reisen auch Kunstschaffende von Basel durchs Birstal nach Biel und verhelfen den Bildwelten der Voyage pittoresque zu internationaler Berühmtheit.
In den 1840er-Jahren durchquert der Franzose Joseph-Philibert Girault de Prangey auf der Suche nach landschaftlichen Schönheiten die Juraketten und hält seine Eindrücke auf Daguerreotypien fest. Gleichzeitig fotografiert die Solothurnerin Franziska Möllinger einzelne Schauplätze von Bedeutung, wie etwa die Verenaschlucht, nutzt die Daguerreotypien als Vorlage für bis heute erhaltene Lithografien und betritt damit Neuland. Die ersten Filmbilder aus dem französischen Jura, eine Produktion der Pathé Frères, stammen schliesslich aus den 1910er-Jahren. Die Gegend profitierte von einem für Werbung und Tourismus geschaffenen Idealbild, wie es beispielsweise durch die pittoresken Landschaftsansichten aus den Ateliers der Kleinmeister vermittelt wird.
Parallel zu dieser Praxis suchen Künstler*innen nach einer neuen Formensprache und einem neuen Blick auf die Landschaft als Hauptdarstellerin. Denn spätestens seitdem die Natur erforscht, erschlossen, beherrscht und in zunehmender Distanz zum Alltag wahrgenommen wird, nimmt die Landschaftsdarstellung in der Malerei an Bedeutung zu. Touristisch motivierte Artefakte begegnen romantischen Auffassungen, ehrfürchtiger Naturanschauung, Darstellungen einer bereits damals zum Klischee gewordenen ländlichen Idylle und realistischen Sondierungen à la Gustave Courbet. Das Landschaftliche ist hier immer ein kulturelles Konstrukt, eine Projektionsfläche, das von grossen Emotionen und immer auch vom jeweiligen Verhältnis zwischen Mensch, Natur und Umwelt spricht.
Idylle versus Realität
Tourismus, ein städtischer Blick oder die Suche nach neuen Repräsentationsformen in der Malerei sehen den Jura als Naturraum und nicht selten möglichst frei von menschlichen Spuren. Längst ist die Region jedoch ein intensiv genutzter Wirtschaftsraum, der im 19. Jahrhundert an Dynamik aufnimmt. Die eisenbahntechnische Erschliessung des Juras, die vor derjenigen der Alpen einsetzt, fällt mit der ersten Boomphase der Uhrenindustrie ab Ende der 1870er-Jahre zusammen.
Die Industrialisierung, ob Präzisions- oder Schwerindustrie, sowie die Umstellung und Intensivierung der Landwirtschaft prägen das Gebiet auf entscheidende Weise und verändern das Landschaftsbild – dies sind Themen, die in der Malerei nur selten oder eher beiläufig vorkommen. Recherchen in Museen, privaten und öffentlichen Archiven haben aber vor allem eines zutage gebracht: Fotografien, die den Wechsel von Positionen und Perspektiven eindringlich vor Augen führen. Schon früh tauchen in den Werken von Wander- und Dorffotograf*innen fast omnipräsent Spuren von Industrialisierung und Modernisierung auf, die einer idealisierten Landschaftsvorstellung entgegentreten.
Der grossartige und mithin wenig bekannte Reichtum an Fotografie im Jura lässt sich in der Ausstellung beispielhaft erfahren anhand einzelner Personen, Dynastien oder Firmen, die von dem Medium Gebrauch machten, so etwa das einzigartige, auch anthropologisch bedeutende fotografische Werk eines Eugène Cattin aus dem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Engagierte Amateur*innen, Industriewerkfotograf*innen, Fotoateliers und regional verwurzelte Reporter*innen, die ungefiltert Lebens- wie Arbeitsverhältnisse und Landschaftswandel dokumentieren, schufen Bildwelten von packender Unmittelbarkeit. Die Bedeutung des Juras als Grenz- und Durchgangsregion wird schliesslich in den Zeugnissen der Kriegsjahre manifest.
Zeitgenössische Perspektiven
Auch für folgende Generationen von Kunst-, Foto- und Filmschaffenden behält der Jura seine Faszination. Wie die jurassische Landschaft einen Künstler formt, zeigt der Filmemacher Marcel Schüpbach 1979 in seiner posthumen Hommage an den Maler Lermite, der davon überzeugt war, dass «jede Landschaft, wie jedes Thema, letztlich dem Maler ähnelt, der sie malt». Fotograf*innen wie Jeanne Chevalier, Monique Jacot, Simone Oppliger oder Balthasar Burkhard, später Thomas Flechtner oder heute Olga Cafiero bewegen sich in einem Spannungsfeld von landschaftlicher Schönheit, Urbanisierung, wirtschaftlichem Aufschwung/Niedergang und teils prekären Lebensrealitäten. Eindrücklich ist der surreal anmutende Blick des Genfer Fotografen Nicolas Faure auf eine Notfallübung vor dem Mont-Russelin-Tunnel auf der A16 im September 1998 oder die fotografische Langzeitrecherche eines Christian Schwager, der seit 2005 die Veränderungen auf der Sondermülldeponie Bonfol ins Bild fasst.
Mit der grundsätzlichen Frage, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, beschäftigt sich Marie José Burki in ihrer 2-Kanal Videoinstallation Grosse kleine Welt (II) von 2013, die, projiziert auf eine gekurvte Wand, an Panoramen aus dem 19. Jahrhundert erinnert. Es ist eine bildmächtige Hommage an ihre Geburtsstadt Biel und eine Referenz an den Schriftsteller Robert Walser, der selbst als feinsinniger Spaziergänger die Jura-Landschaft durchstreifte und sie in seinen Schriften zum Katalysator für das Nachdenken über die eigene Existenz werden lässt.
Darüber hinaus wartet die Schau mit zwei Premieren auf. Die aus dem Vallée de Joux stammenden Anne und Jean Rochat besuchen für eine Serie von Videoperformances erneut spezifische Gebiete und Orte, die in den Gemälden der Ausstellung eine Rolle spielen. Dabei fragen sie nach dem veränderten Blick auf die «Natur» zwischen damals und heute im Zeit-alter des postulierten Anthropozäns.
Der in Mervelier ansässige Augustin Rebetez ist mit dem Jura seit jeher eng verknüpft, wo seine Faszination für die sichtbare und spirituelle Welt unmissverständlich wurzelt. Für die Ausstellung schafft der Künstler neue ortsspezifische Werke, die in den Park ausgreifen, als Neonblitze die Fassade beleuchten und das Museumsfoyer mit Texten über die Jura-Landschaft und seiner unverkennbaren Bildwelt in einen poetischen Raum verwandeln.
Jurabilder / Imaginaires du Jura versteht sich als Einladung, den Jura durch die Linse von Kunst, Fotografie und Film aus unterschiedlichen Perspektiven neu zu betrachten.
Kunst-, Foto, und Filmschaffende in der Ausstellung:
Eva Aeppli, Cuno Amiet, Caroline Bachmann, Agnes Barmettler, Jacques Bélat, Peter Birmann, Paul Bonzon, Frank Buchser, Max Burgmeier, Balthasar Burkhard, Marie José Burki, Olga Cafiero, Elizabeth Campbell, Edouard Castres, Agnes Catlow, Eugène Cattin, Jeanne Chevalier, Coghuf, Gustave Courbet, Alphonse Deriaz, Johann Friedrich Dietler, André Dolmaire, Hermann Eidenbenz, Willi Eidenbenz, François-Joseph Enard, Nicolas Faure, Hans Finsler, Thomas Flechtner, Theo Frey, Samuel Frey (zugeschrieben), Werner Friedli, Otto Frölicher, Arthur Gammeter, Hans Gerber, Franz Graff, Amédée Gremaud, Joseph Gusy, Robert Hainard, Ferdinand Hodler, Monique Jacot, Edouard Jeanmaire, Jacques-Henri Juillerat, Edouard Kaiser, Heinrich Keller, Le Corbusier, Charles L'Eplattenier, Lermite, Arthur Henri Maire, Barthélemy Menn, Matthäus Merian d. Ältere, Maximilien De Meuron, Laurent Louis Midart, Walter Mittelholzer, Franziska Möllinger, Meret Oppenheim, Eduard Friedrich Pape, André Paratte, Pathé Frères, Nicolas Pérignon, Albert Perronne, Auguste Pointelin, Joseph-Philibert Girault de Prangey, Auguste Quiquerez, Edouard Quiquerez, Augustin Rebetez, Didier Rittener, Léo-Paul Robert, Philippe Robert, Anne und Jean Rochat, Christoph Rust, Roland Schneider, Albert Schnyder, Marcel Schüpbach, Christian Schwager, Paul Senn, Theodor Strübin, Jean Tinguely, Jakob Tuggener, Karl Walser, Bernard Willemain und Caspar Wolf
Besonderer Dank an den Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn, die UBS Kulturstiftung, Däster-Schild Stiftung, Baloise, Ernst Göhner Stiftung, Pro Helvetia, Emil und Rosa Richterich-Beck Stiftung, Videocompany, Zofingen, sowie an alle institutionellen und privaten Leihgeber*innen.
Kuratiert von Katrin Steffen; Marianne Burki, Kunsthistorikerin und Kuratorin; Markus Schürpf, Kunst- und Fotografiehistoriker, Fotobüro Bern; Daniel Schwartz, Fotograf und Tuula Rasmussen, Wiss. Mitarbeiterin